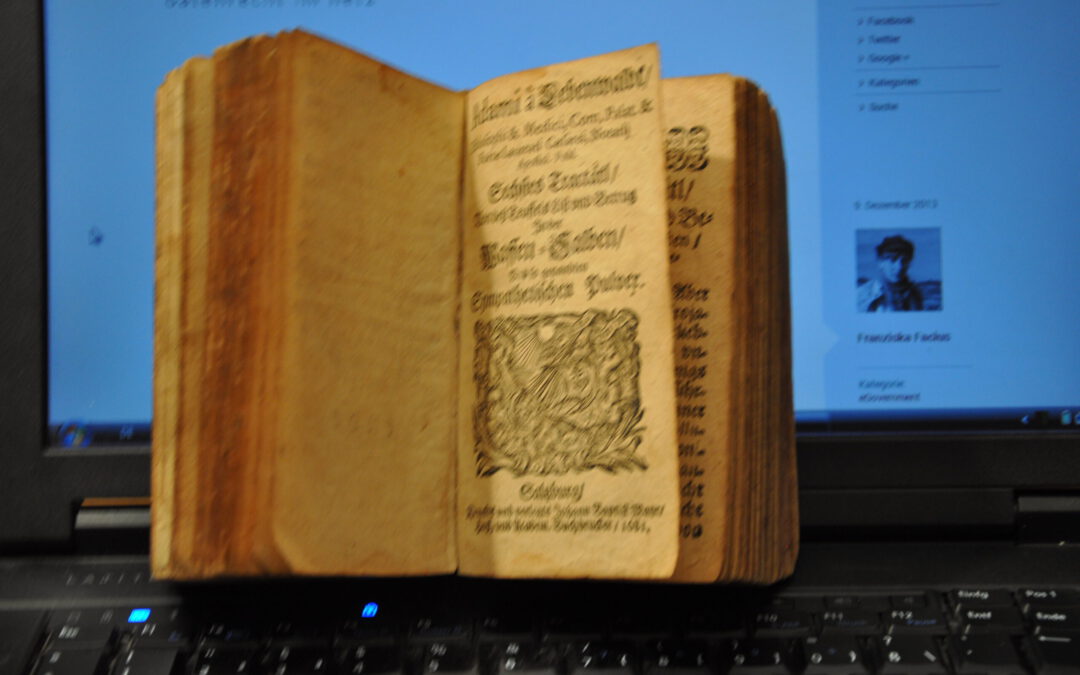
Die Fastnacht im 15. Jahrhundert in Nürnberg: Ein Spiegel gesellschaftlicher Missstände und früher #MeToo-Momente
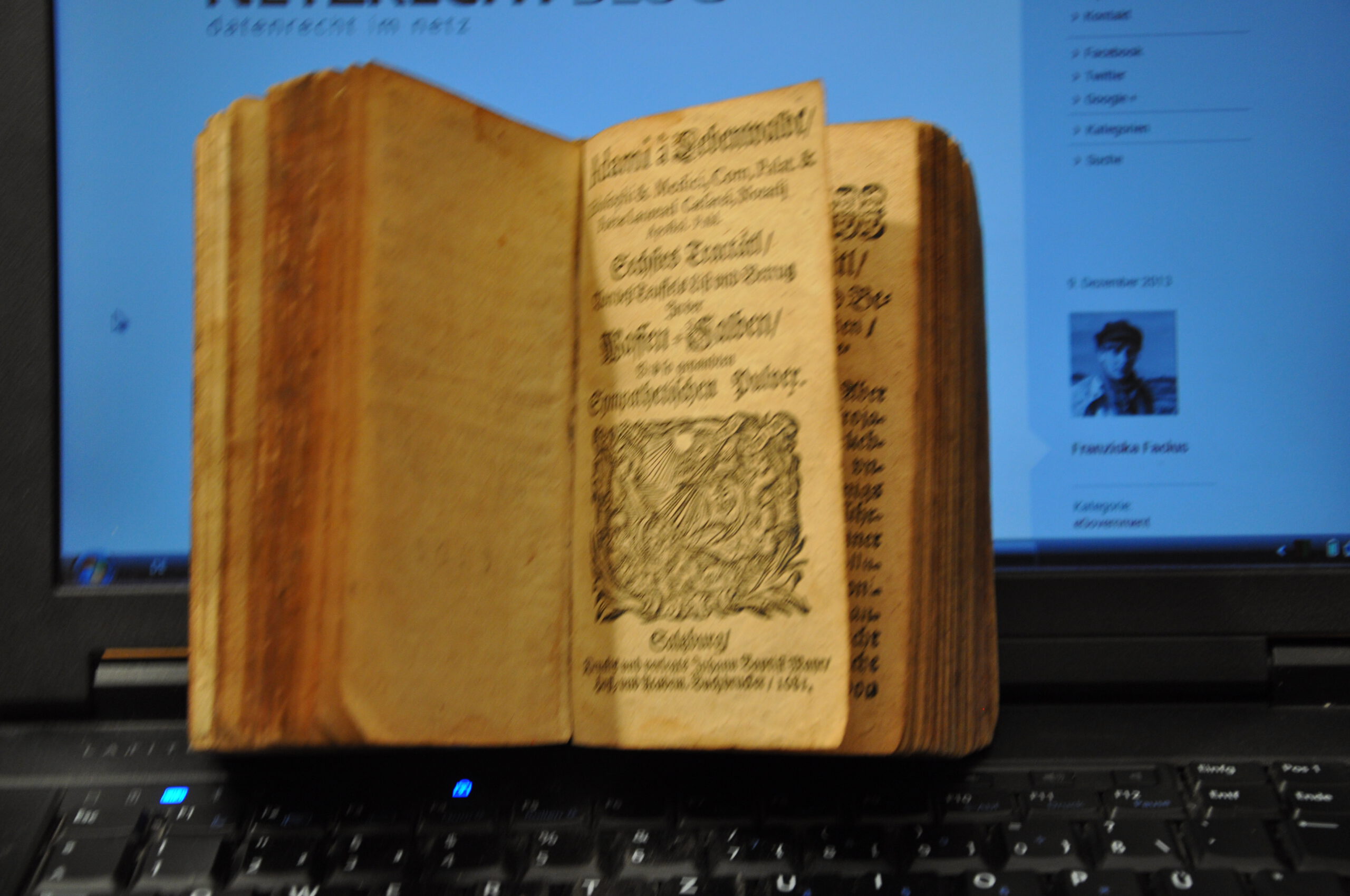
Die Ursprüngen der Fastnacht und ihrer Bräuche sind in der Wissenschaft umstritten. Es gibt verschiedene Theorien zur Herleitung, doch eine deutliche Verbindung zu den kirchlichen Mysterienspielen und den römischen Saturnalien ist erkennbar. Jaques Heers bemerkt dazu: „Es mag verwunderlich oder gar paradox erscheinen, aber die Narrenfeste, Feiern der Unordnung, der auf den Kopf gestellten Hierarchien, haben sich ausnahmslos in kirchlichen Kreisen entfaltet.“ (Heers, Vom Mummenschantz und Machttheater, S.37.) Die Fastnacht ist also keineswegs ein rein weltliches Vergnügen, sondern wurzelt in religiösen Festen, in denen soziale Ordnungen temporär aufgehoben wurden.
Im späten Mittelalter spielte Nürnberg eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung der städtischen Fastnacht. Die Fastnacht diente nicht nur als Zeit des ausgelassenen Feierns, sondern auch als Ventil für gesellschaftliche Kritik. Besonders die Fastnachtsspiele waren eine bühnenhafte Darstellung von Missständen und sozialen Ungerechtigkeiten. Dazu gehörten auch Themen wie sexuelle Belästigung von Frauen, die damals wie heute eine traurige Realität waren. Dies lässt sich in Werken von Hans Folz nachweisen, einem bekannten Meistersinger und Fastnachtsspielautor des 15. Jahrhunderts.
Frauen und Fastnacht: Schutzlos selbst in Männerkleidung
In einem Fastnachtsspiel von Hans Folz wird eine Gerichtsverhandlung inszeniert, in der die personifizierte Fastnacht angeklagt wird. Eine besondere Rolle spielt hierbei die Anwältin der Frauen, die vor Gericht das Wort führt. Dies ist eine bemerkenswerte Besonderheit, denn im mittelalterlichen Nürnberg waren Frauen als Anwälte nicht zugelassen. Redner vor Gericht waren ausnahmslos Männer. Der Grund, warum der Verfasser dennoch eine Frau als Anklägerin einsetzte, liegt vermutlich in einem Interessenkonflikt: Ein Mann hätte sich schwerlich glaubwürdig gegen das Verhalten seines eigenen Geschlechts aussprechen können, ohne sich selbst und seine Geschlechtsgenossen anzuklagen. Die Lösung bestand also darin, eine Frau das Wort führen zu lassen.
Die Anwältin klagt unter anderem an, dass Frauen sich nicht einmal durch das Tragen von Männerkleidung vor sexueller Belästigung schützen konnten. Sobald sie „entlarvt“ wurden, waren sie dem männlichen Zugriff schutzlos ausgeliefert:
„Leg wir dann mannes kleider an vnd mayn, dest sichrer gan, sobald sie erfarn einer oder zwen, so wils keiner allein lassen gan. Jgklicher spricht: wol auff, ge mit mir!“ (Nürnberger Fastnachtspiele des 15. Jahrhunderts von Hans Folz und seinem Umkreis. Edition und Kommentar. Herausgegeben von: Stefan Hannes Greil und Martin Przybilski. In Zusammenarbeit mit: Theresia Biehl , Christoph Gerhardt und Mark Ritz, S. 387-407, S. 398)
Dieses Zitat verdeutlicht, dass Frauen trotz Verkleidung nicht sicher vor Übergriffen waren. Die Fastnacht bot einen Raum, in dem Männer sich ermutigt fühlen konnten, Frauen sexuell zu belästigen. Dies lässt sich als eine frühe Form eines #MeToo-Moments interpretieren.
Die personifizierte Fastnacht als Angeklagte
Interessanterweise werden in dem Fastnachtsspiel nicht die Männer direkt angeklagt, sondern die personifizierte Fastnacht selbst. Dabei wird die Fastnacht weiblich dargestellt, was bereits in der deutschen Sprache mit dem weiblichen Artikel „die Fastnacht“ angedeutet wird. In ihrer Verteidigung argumentiert sie, dass sie selbst nichts für das Verhalten der Männer könne und dass die Fastnacht lediglich ein Fest der Freude und des ausgelassenen Feierns sei. Der Verfasser des Stücks lenkt so die Verantwortung von den einzelnen Tätern weg und macht die Fastnacht als institutionelles Ereignis zum Mittelpunkt der Anklage.
Der Richter, der die Verhandlung leitet, hört nicht nur die Frauen an, sondern auch Vertreter aller sozialen Stände: Adel, Bauern, Bürger und Handwerker klagen die Fastnacht an. Doch schließlich entscheidet er zugunsten der Fastnacht, da das Feiern als alter Brauch geschätzt wird und nicht abgeschafft werden soll. Dieses Urteil zeigt die Ambivalenz der Fastnacht: Einerseits ist sie eine Zeit der Kritik und der Aufhebung gesellschaftlicher Normen, andererseits genießt sie eine Art Schutzstatus als Tradition, sodass sie trotz berechtigter Einwände nicht infrage gestellt wird.
Tradition ./. Recht auf eine sichere Feier?
Die Fastnacht galt traditionell als eine Zeit, in der Normen und Hierarchien aufgehoben wurden. Doch in dieser Umkehrung der Ordnung lag auch die Gefahr für Frauen, noch wehrloser zu sein als ohnehin schon. Während die Verkleidung in gewisser Weise Schutz versprach, wurde sie nach ihrer Aufdeckung zur Einladung für Übergriffe.
Parallelen zur Gegenwart
Die Problematik sexueller Belästigung ist kein modernes Phänomen. Was wir heute unter #MeToo zusammenfassen, hatte bereits im Mittelalter einen Platz in der gesellschaftlichen Realität. Die Fastnachtsspiele und ihre Darstellungen von Frauen in einer schutzlosen Rolle zeigen, dass das Problem der sexuellen Übergriffigkeit kein neues ist.
Die Tatsache, dass bereits in den Fastnachtsspielen des 15. Jahrhunderts sexuelle Belästigung thematisiert wurde, zeigt, dass das Bewusstsein für diese Problematik keineswegs erst in der Moderne entstanden ist. Das Mittelalter mag vergangen sein, doch der Kampf gegen sexuelle Gewalt ist und bleibt aktuell. Die Geschichte zeigt, dass sexuelle Belästigung gegen Frauen ein Dauerthema seit Jahrhunderten ist. Der Kampf gegen sexuelle Belästigung ist nicht nur eine Aufgabe der Betroffenen, sondern eine gesellschaftliche Verantwortung.





