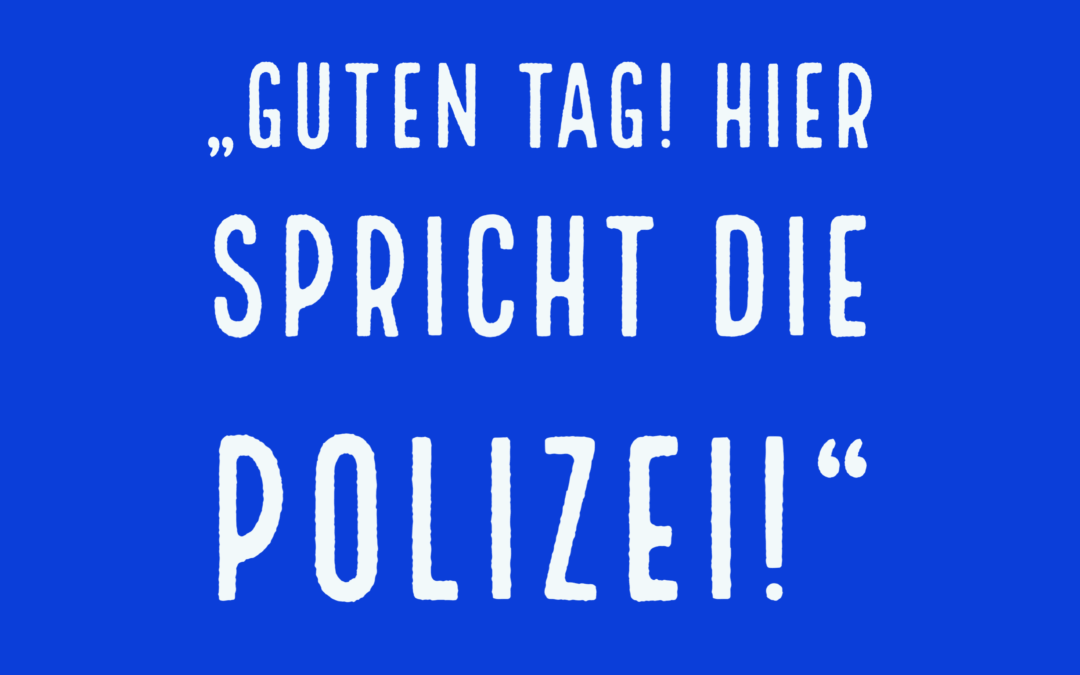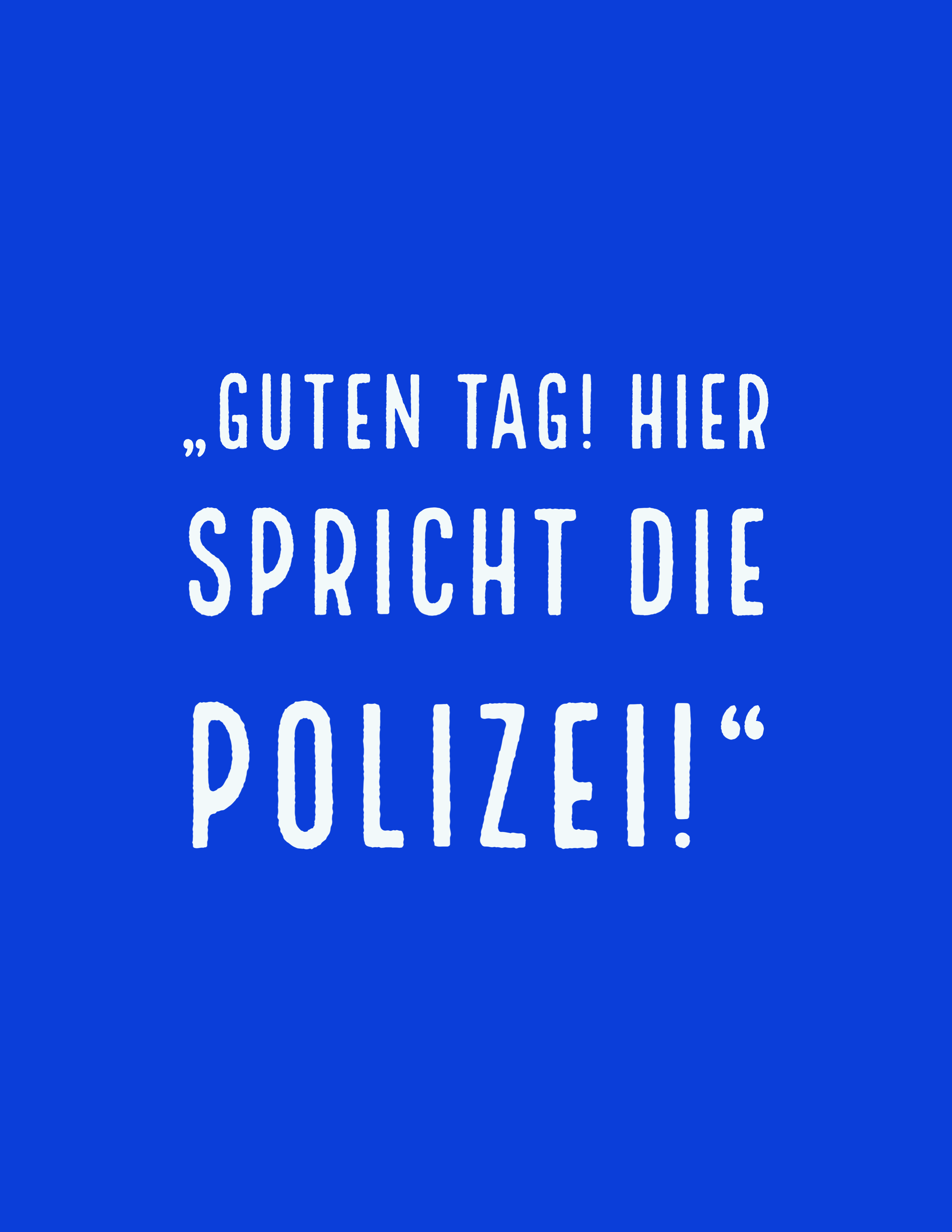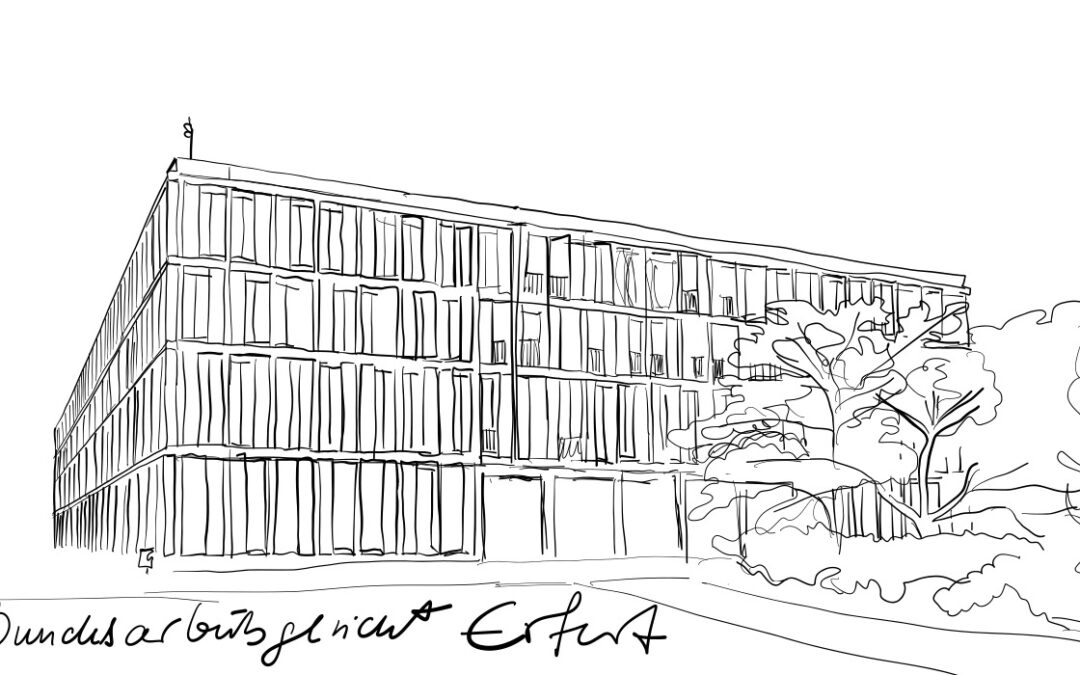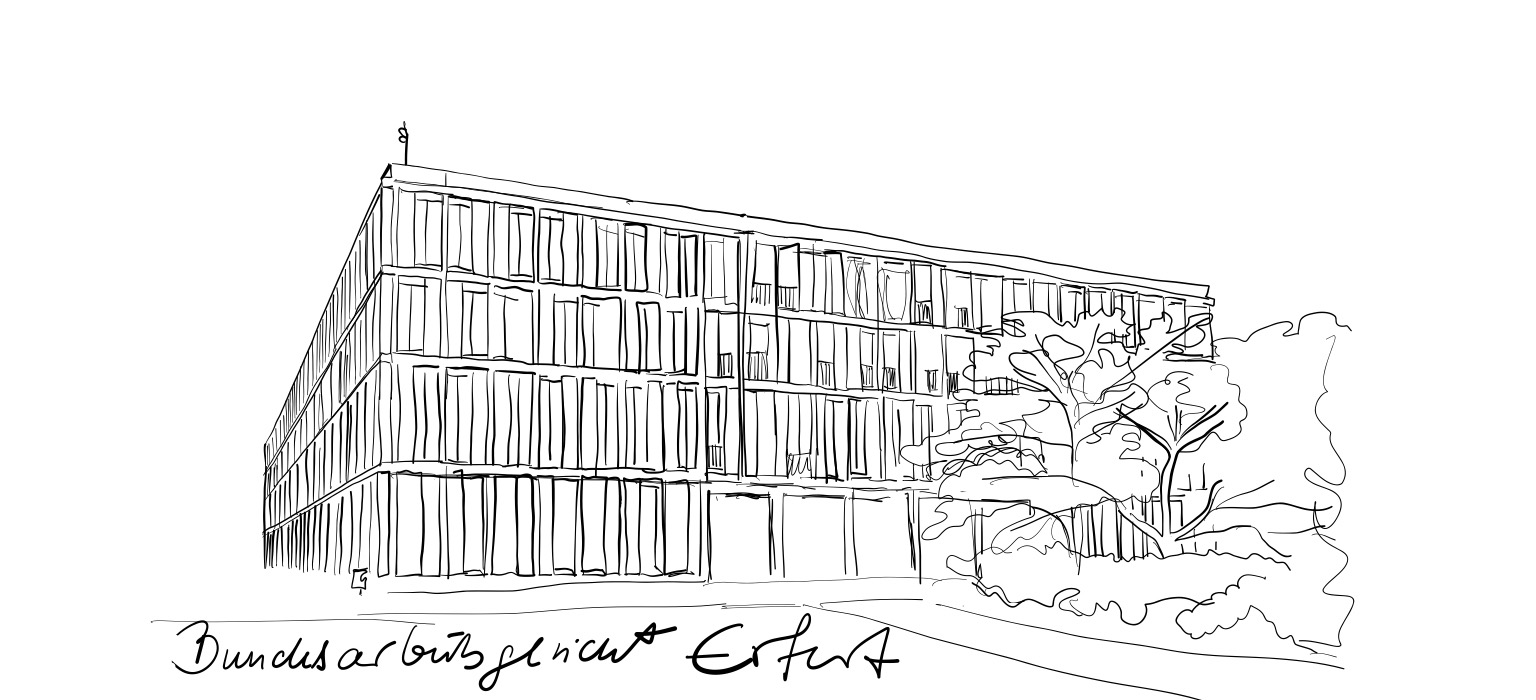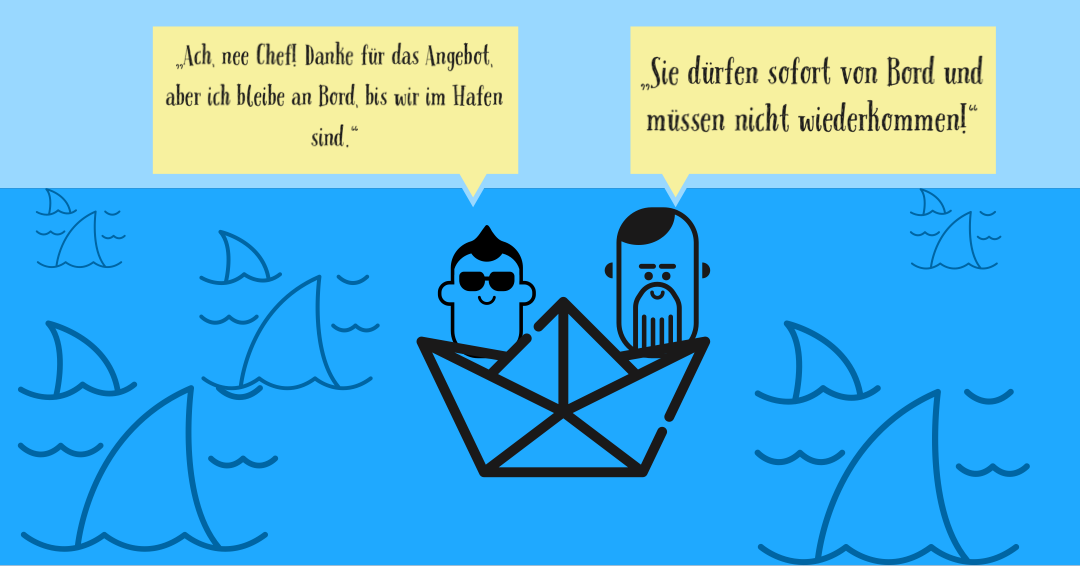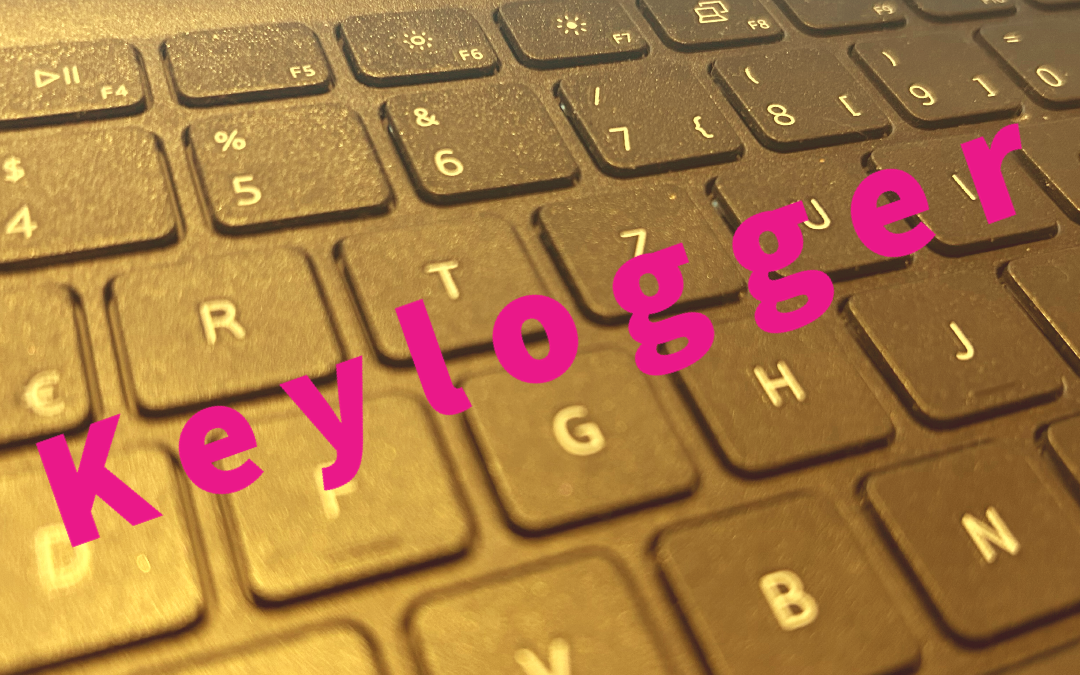
Der Einsatz von Keyloggern am Arbeitsplatz
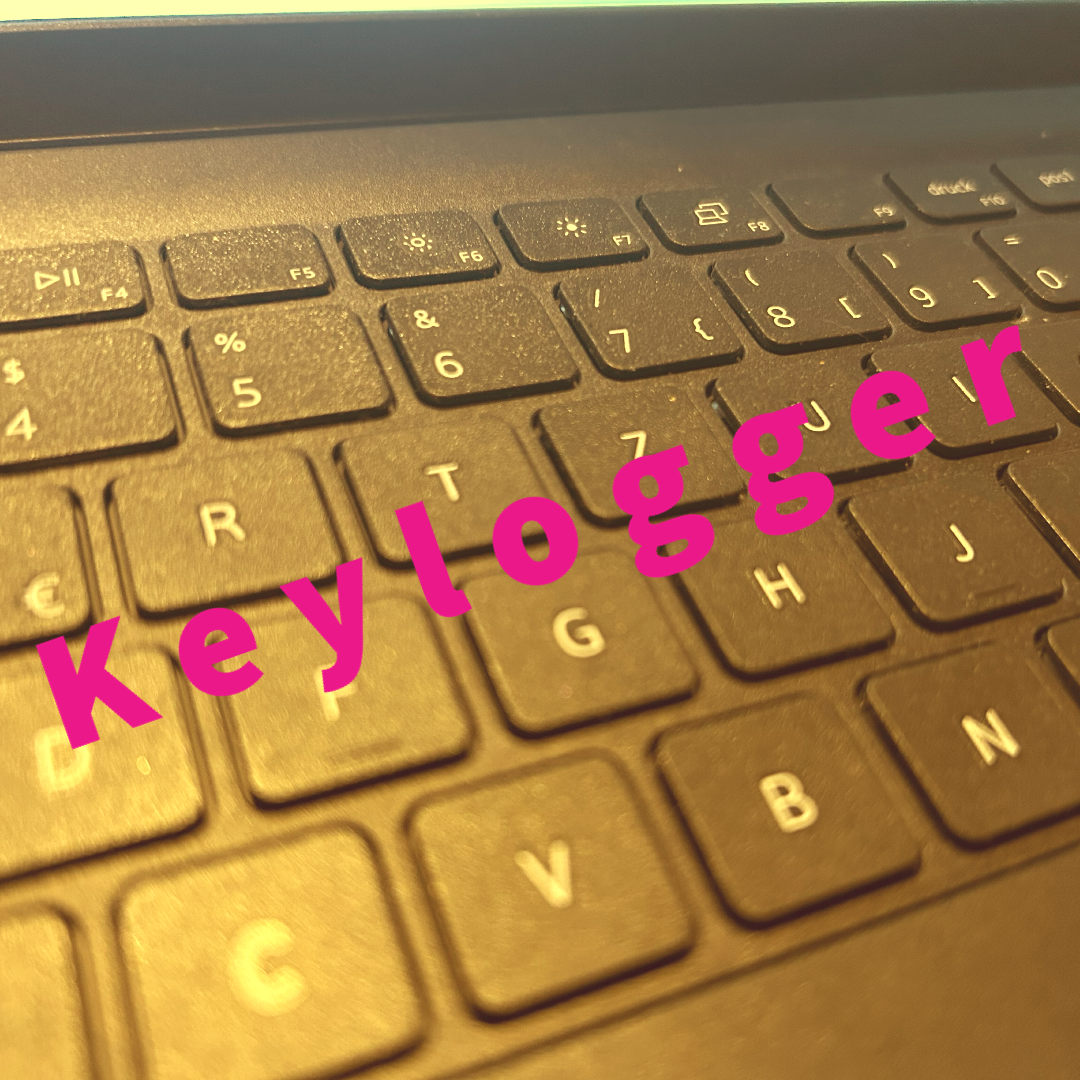
Der Einsatz von Keyloggern am Arbeitsplatz
Definition und Funktionsweise eines Keyloggers
Ein Keylogger ist eine Software oder ein Hardwaregerät, das sämtliche Tastatureingaben eines Computers aufzeichnet. Dies kann zur umfassenden Überwachung der Nutzung eines Computers durch den Arbeitgeber eingesetzt werden. Neben der Kontrolle, welche Tätigkeiten ein Arbeitnehmer während seiner Arbeitszeit ausführt, kann ein Keylogger auch dazu dienen, die Geschwindigkeit und Effizienz der Arbeitsweise zu analysieren. Durch die Aufzeichnung von Tastenanschlägen und die Erfassung von Zeitintervallen zwischen den Eingaben lassen sich detaillierte Rückschlüsse auf die Arbeitsweise eines Mitarbeiters ziehen.
Sachverhalt des Urteils (BAG, Urteil vom 27. Juli 2017 – 2 AZR 681/16)
Im vorliegenden Fall ging es um einen Webentwickler, der seit 2011 bei einem Unternehmen tätig war. Der Arbeitgeber hatte auf dem Dienst-PC des Mitarbeiters einen Keylogger installiert, ohne diesen zuvor konkret über diese Maßnahme zu informieren. Die durch den Keylogger erfassten Daten zeigten, dass der Arbeitnehmer während der Arbeitszeit private Tätigkeiten ausführte, darunter die Entwicklung eines Computerspiels sowie das Bearbeiten geschäftlicher E-Mails für das Unternehmen seines Vaters. Dies führte zur außerordentlichen fristlosen Kündigung des Arbeitnehmers. Der Arbeitnehmer klagte gegen die Kündigung und argumentierte, dass die Überwachungsmaßnahme gegen sein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung verstoße und damit unzulässig sei.
Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschied mit Urteil vom 27. Juli 2017 (Az. 2 AZR 681/16), dass die Kündigung des Arbeitnehmers unwirksam sei, da die durch den Keylogger gewonnenen Erkenntnisse einem Verwertungsverbot unterliegen. Nach der Entscheidung verstößt die heimliche Erfassung und Speicherung von Tastatureingaben gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers, das sich aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz (GG) ergibt.
Die zentralen rechtlichen Erwägungen des Gerichts waren, dass die Überwachung durch einen Keylogger einen tiefgreifenden Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers darstellt. Ein solcher Eingriff ist nur dann zulässig, wenn ein durch konkrete Tatsachen begründeter Verdacht auf eine Straftat oder eine schwerwiegende Pflichtverletzung besteht. Eine allgemeine Kontrolle der Arbeitsweise oder der Arbeitsgeschwindigkeit ohne einen spezifischen Verdacht wird als unverhältnismäßig angesehen und ist nicht durch § 32 Abs. 1 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG a.F.) gerechtfertigt. Da die durch den Keylogger gewonnenen Erkenntnisse unter Verstoß gegen diese Grundsätze erlangt wurden, unterliegen sie einem Verwertungsverbot und dürfen im Kündigungsschutzprozess nicht berücksichtigt werden.
Interessenabwägung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Die Entscheidung des BAG zeigt die grundlegende Abwägung zwischen dem berechtigten Interesse des Arbeitgebers an der Überwachung der Arbeitsleistung und den Rechten der Arbeitnehmer auf Datenschutz und Privatsphäre.
Argumente zugunsten des Arbeitgebers
- Arbeitgeber haben ein legitimes Interesse daran, die Arbeitszeit ihrer Angestellten effizient zu nutzen und Verstöße gegen betriebliche Vorgaben zu ahnden.
- Die Kontrolle von Arbeitsgeschwindigkeit und -qualität ist insbesondere in digitalisierten Arbeitsbereichen relevant, in denen Produktivität häufig anhand von Tastatureingaben, Bearbeitungszeiten oder Nutzeraktivitäten gemessen wird.
- In sicherheitskritischen Branchen oder bei besonders sensiblen Daten kann eine lückenlose Kontrolle helfen, Regelverstöße oder Datenmissbrauch frühzeitig zu erkennen.
- Eine unkontrollierte private Nutzung betrieblicher IT-Systeme kann nicht nur die Arbeitsleistung, sondern auch die Sicherheit von Unternehmensnetzwerken gefährden.
- Das Urteil könnte dazu führen, dass Arbeitgeber weniger Möglichkeiten haben, sich gegen unerlaubte private Nutzung oder ineffiziente Arbeitsweisen zur Wehr zu setzen.
Argumente zugunsten des Arbeitnehmers
- Auf der anderen Seite schützt die Entscheidung des Gerichts das Grundrecht der Arbeitnehmer auf informationelle Selbstbestimmung und Privatheit im Arbeitsverhältnis.
- Eine ständige Überwachung durch Keylogger könnte Arbeitnehmer einem unzumutbaren Anpassungsdruck aussetzen, da sie jederzeit mit einer vollständigen Kontrolle ihrer Arbeitsweise rechnen müssen.
- Die Erfassung von Tastatureingaben gibt nicht nur Aufschluss über die Produktivität, sondern kann auch private oder hochsensible Informationen wie Passwörter oder persönliche E-Mails aufzeichnen.
- Arbeitnehmer sollten nicht pauschal unter Verdacht gestellt werden; eine Überwachung darf nur erfolgen, wenn konkrete Verdachtsmomente vorliegen.
Schlusspunkt
Die Entscheidung des BAG setzt klare Grenzen für den Einsatz von Keyloggern im Arbeitsverhältnis. Arbeitgeber müssen vor der Implementierung solcher Überwachungstechnologien sicherstellen, dass eine rechtliche Grundlage für deren Einsatz besteht und die Maßnahme verhältnismäßig ist. Das Urteil macht deutlich, dass eine verdachtsunabhängige, vollständige Überwachung der Arbeitsweise von Beschäftigten nicht zulässig ist. Gleichzeitig bleibt es Arbeitgebern möglich, in begründeten Fällen gezielte Kontrollmaßnahmen zu ergreifen.