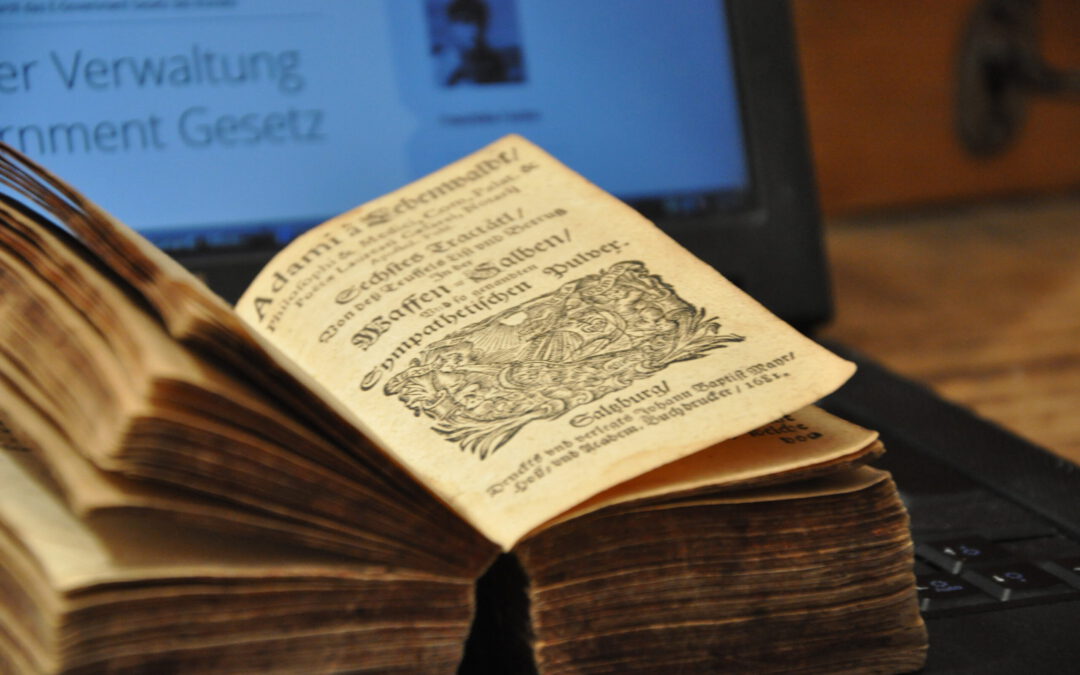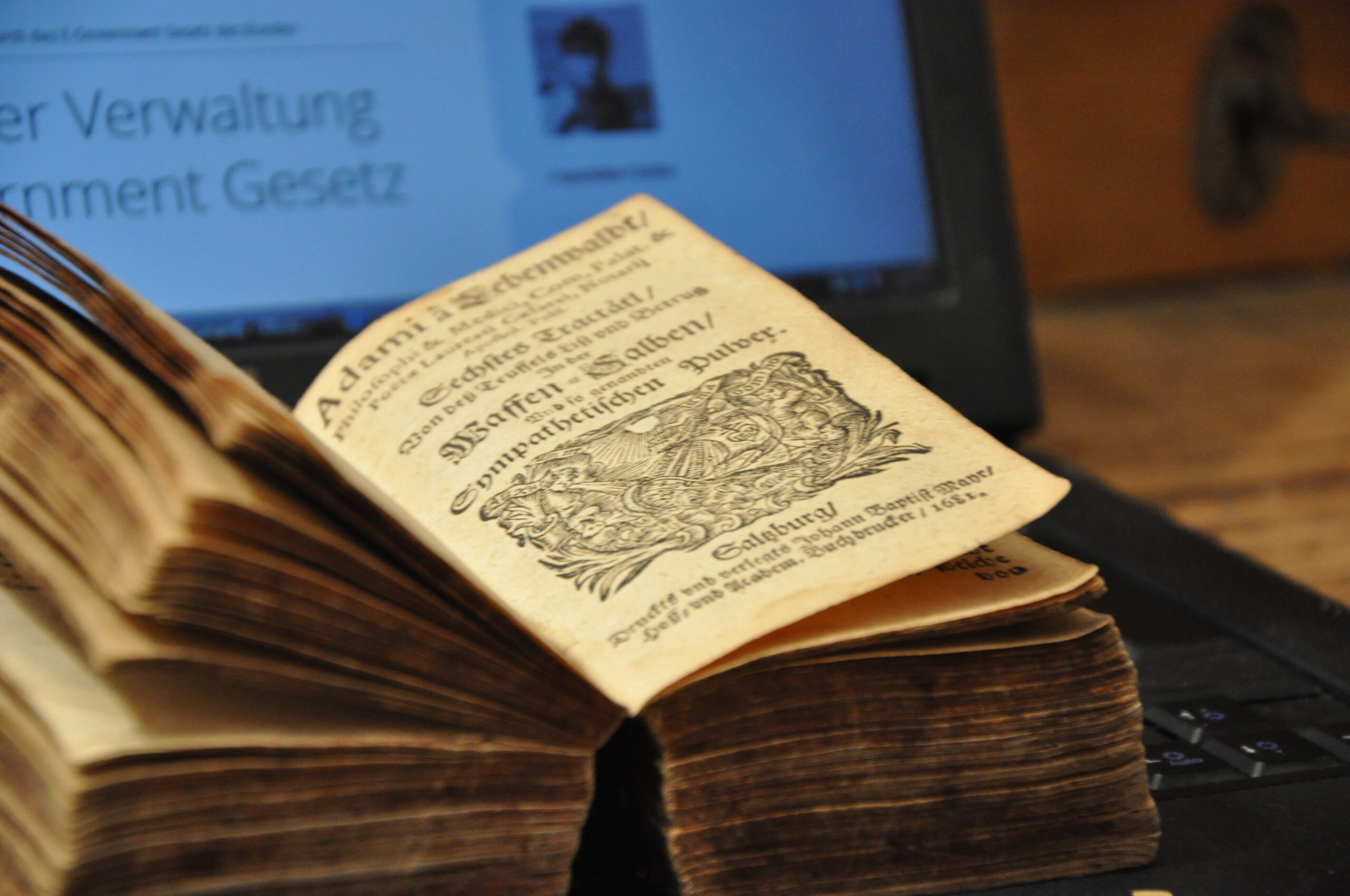Kein Feststellungsinteresse des Sozialversicherungsträgers für eine Erbenfeststellungsklage

Der Bundesgerichtshof hat entschieden (Beschluss vom 2. November 2022, Az. IV ZR 39/22), dass ein Sozialhilfeträger keinen direkten Einfluss auf erbrechtliche Entscheidungen nehmen kann, selbst wenn wirtschaftliche Interessen im Raum stehen. Dem Sozialhilfeträger fehlt für eine solche Feststellung das sogenannte rechtliche Interesse. Er kann nicht feststellen lassen, dass eine Sozialleistungsbezieherin Erbin ist und die Erbschaft nicht wirksam zugunsten ihrer Kinder ausschlagen kann.
Der Fall
Die Erbin hatte Sozialleistungen nach dem SGB II erhalten. Sie schlug die Erbschaft aus, nachdem ihre Mutter verstorben war. Dadurch wurden ihre Kinder Erben. Der zuständige Sozialversicherungsträger, der über Jahre hinweg finanzielle Leistungen gewährt hatte, wollte daraufhin gerichtlich feststellen lassen, dass die Sozialleistungsempfängerin dennoch Erbin geworden ist. Ziel war es, Rückzahlungsansprüche gegen sie geltend zu machen.
Rechtliche Beurteilung durch den BGH
Der BGH hat entschieden, dass dem Sozialversicherungsträger kein rechtliches Feststellungsinteresse nach § 256 ZPO zusteht. Das Recht zur Ausschlagung einer Erbschaft ist ein höchstpersönliches Recht des Erben und kann nicht auf Dritte übergehen – auch nicht auf einen Sozialleistungsträger. Ein Sozialhilfeträger hat zwar möglicherweise ein wirtschaftliches Interesse an der Erbenstellung, doch dieses allein genügt nicht, um ein Feststellungsinteresse im juristischen Sinne zu begründen. Die Klage wurde daher als unzulässig abgewiesen.
Was ist ein höchstpersönliches Recht ?
Dies ist ein Recht, das ausschließlich von einer bestimmten Person selbst ausgeübt werden kann. Es ist also nicht übertragbar, vererbbar oder durch eine andere Person wahrnehmbar. Solche Rechte betreffen sehr persönliche Entscheidungen und können nur von der betroffenen Person selbst ausgeübt werden. Ein Beispiel dafür ist das Recht zur Eheschließung nach § 1311 BGB. Nur die beiden Partner können eine Ehe eingehen, niemand kann dies stellvertretend für sie tun. Auch das Recht zur Erbausschlagung nach § 1942 BGB zählt dazu, wie dies der BGH bestätigt hat. Ein weiteres höchstpersönliches Recht ist die Testierfreiheit nach § 1937 BGB. Jeder kann in einem Testament frei bestimmen, wer sein Erbe wird, und niemand kann ihm diese Entscheidung abnehmen oder für ihn ein Testament verfassen.
Folgen für Erben und Sozialversicherungsträger
Der Beschluss des BGH stellt klar, dass Sozialleistungsbezieher frei entscheiden können, ob sie eine Erbschaft annehmen oder ausschlagen. Sie müssen nicht befürchten, dass ein Sozialhilfeträger dies nachträglich angreift. Der BGH bestätigt, dass die Erbausschlagung ein unantastbares, persönliches Recht des Erben bleibt.